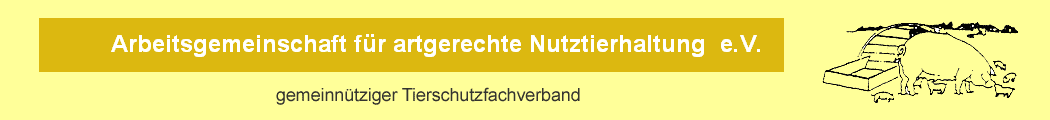2023
Gedanken zu den Gründen der Aufgabe der eigenen Schlachtung örtlicher Metzgereien
Leserbrief im Winsener Anzeiger am 25.10-2023 von Eckard Wendt
Thema: „Brauchen wir ein neues System“ (der Schweinehaltung) bei topagrar.com
Den Bericht finden sie hier
Kommentar von Eckard Wendt
Ich denke, die Bereitschaft der Verbraucher, sich für (Schweine-)Fleisch aus höheren Haltungsstufen zu höheren Preisen zu entscheiden, würde deutlich zunehmen, wenn die Haltungsstufen in der Werbung und über Aushänge in den Geschäften mitbildlich dargestellt werden würden … also nicht mit geschönten Darstellungen gearbeitet werden würde wie z.B. bei der IGW im Zusammenhang mit dem Schweinemobil, das jeden Morgen vor Hallenöffnung gereinigt wurde … im Gegensatz zu den Mastbuchten.
(am 31.10.23 noch nicht freigeschaltet)
Thema: Insekten-Eiweiß
Leserbrief von Ingrid Wendt zu Minister Özdemirs Absicht, Insekten-Eiweiß als lebensmitteltauglich zuzulassen.
Der Schrecklichste der Schrecken
Thema: Herkunftskennzeichnung für tierische Produkte
Nach jahrelangen entsprechenden Forderungen seitens der Tier- und Verbraucherschützer sowie mehr als 10 Jahre nach Einführung der Eierkennzeichnung, die sich als Erfolgsmodell erwies, tut sich der Gesetzgeber in Form des Landwirtschaftsministeriums immer noch schwer, statt der freiwilligen Kennzeichnung im Rahmen der „Initiative Tierwohl“ (ITW) endlich Nägel mit Köpfen zu machen und klare gesetzliche Festsetzungen einzuführen. Die Folge sind immer mehr Label von Discountern und zwei Tierschutzverbänden. Das ist alles andere als hilfreich, weil es allenfalls dem Handel dient, jedoch auf die Kunden wie „Nebelbomben“ wirkt.
Wir halten es für sinnvoll, dass Verbraucher nicht mit ihren Wünschen hinter den Berg halten, sondern Parteien und Regierungen durch entsprechende Forderungen auf Trapp zu bringen. Ein Mittel in diesem Sinne sind Leserbriefe. Nachstehend finden Sie einige Beispiele.